Lektion 12 – Proof of Work (PoW) vs Proof of Stake (PoS)

Was bedeutet Proof of Work (PoW)?
Der Begriff „Proof of Work (PoW)“ bezeichnet einen dezentralen Konsensmechanismus, welcher für die Generierung und Validierung neuer Blöcke einer Blockchain verwendet wird. Wobei alle neuen Transaktionen von Kryptowährungen vor der Aufnahme ins Netzwerk durch die Blockchain-Teilnehmer mittels eines Arbeitsnachweises überprüft werden.
Vereinfacht ausgedrückt ist der PoW ein Wettbewerb zwischen allen Netzwerkmitgliedern, wobei es grundsätzlich darum geht, ein komplexes mathematisches Problem zu lösen, dessen Lösung seitens der anderen Teilnehmer leicht zu validieren ist. Derjenige, der den richtigen Hash am schnellsten findet, wird hierfür belohnt. Dieser wirtschaftliche Anreiz stellt sicher, dass sich genügend Personen weltweit am Netzwerk beteiligen, um es am Laufen zu halten und noch zu verlässlicher zu gestalten.
Sämtliche Transaktionen innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls werden dabei zu einem Block zusammengefasst. Bevor ein Knotenpunkt (Node) den neuen Block dann übertragen kann, wird zuerst eine gewisse Menge Rechenleistung abverlangt, die zur Lösung einer komplexen Rechenaufgabe benötigt wird. Derjenige Netzwerkteilnehmer, der als erstes die Aufgabe löst, generiert einen sogenannten Hash aus der Lösung und den Blockinhalt. Dieser muss bestimmte Voraussetzung erfüllen, die im jeweiligen Netzwerkprotokoll festgelegt sind. Wurde schließlich der richtige Hashwert gefunden und von den anderen Netzwerkmitgliedern hinsichtlich seiner Gültigkeit validiert, darf der neue Block an die Blockchain angehängt werden.

Was bedeutet Proof of Stake (PoS)?
PoS-Systeme wurden entwickelt, um einige der Ineffizienzen und entstehenden Probleme zu lösen, die bei PoW-basierten Blockchains häufig auftreten. Dabei geht es insbesondere um die mit dem PoW-Mining verbundenen Kosten, wie dem Stromverbrauch und der Hardware.
Im Gegensatz zum Proof of Work werden die Blöcke nicht durch Wettbewerb zwischen den Minern und enormer Rechenleistung validiert (d.h. derjenige der den richtigen Hash-Wert als erster findet, bekommt die Belohnung), sondern ein Algorithmus entscheidet i.d.R. wer als Validierer in Frage kommt. D.h. um Blöcke der Blockchain hinzuzufügen zu können, müssen die Nodes nicht durch energieintensives Schürfen gegeneinander antreten, sondern lediglich eigene Coins oder Token als Sicherheit im Netzwerk hinterlegen und können dann mit ihrer Computerhardware auf der Grundlage der Einlage Daten auf ihre Gültigkeit überprüfen.
Anders als beim PoW ist in PoS-Netzwerken deshalb kein energieaufwändiges Mining erforderlich.
Um von dem Algorithmus als Validierer ausgewählt zu werden, gibt es generell mehrere Möglichkeiten. Die gängigste ist, dass die Höhe der hinterlegten Coins und Token entscheidet, d.h. desto höher der Besitz bzw. Einsatz ist an Coins oder Token ist, desto wahrscheinlicher ist es, als Block-Validierer ausgewählt zu werden. Eine weitere bekannte Methode ist, dass das Alter der eingesetzten Coins oder Token entscheidend ist. Je länger die Kryptowährungen nicht genutzt wurden, desto größer ist die Chance, für die Validierung ausgewählt zu werden. Das Alter wird auf null zurückgesetzt, sobald die Coins oder Token zur Verifizierung eines Blocks eingesetzt wurden. Eine dritte Möglichkeit ist das Zufallsprinzip, d.h. der niedrigste Hash-Wert wird in Kombination mit dem höchsten Einsatz für die Validierung des Blocks ausgewählt.
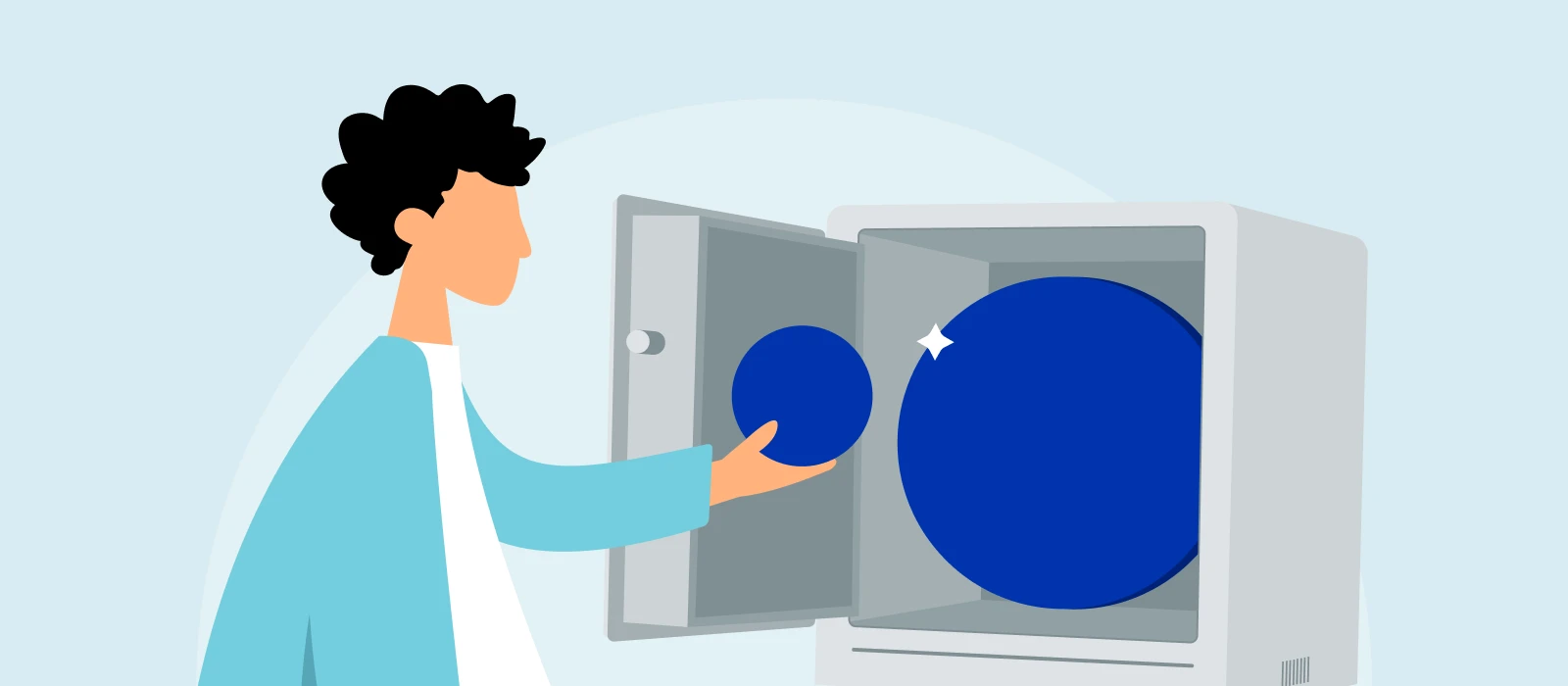
Quellen
Conway, L. (2023b) “What Is Bitcoin Halving? Definition, How It Works, Why It Matters,” Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/bitcoin-halving-4843769, last accessed 23.09.2023.
Frankenfield, J. (2023d) “What Is Proof of Work (PoW) in Blockchain?,” Investopedia . Available at: https://www.investopedia.com/terms/p/proof-work.asp, last acessed 12.09.2023.
What is Proof-of-Work? – A Deep Dive (2023). Available at: https://www.realvision.com/blog/what-is-proof-of-work, last accessed 12.09.2023.
What is Proof of Work? | Research & Fundamentals | Bitcoin Suisse (2021). Available at: https://www.bitcoinsuisse.com/news/what-is-proof-of-work, last accessed 12.09.2023.
Cointelegraph (2017) “The History and Evolution of Proof-of-Stake,” 15 October. Available at: https://cointelegraph.com/news/the-history-and-evolution-of-proof-of-stake, last accessed 12.09.2023.
Frankenfield, J. (2023c) “What Does Proof-of-Stake (PoS) Mean in Crypto?,” Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/terms/p/proof-stake-pos.asp, last accessed 12.09.2023.
Ethereum (2023) Proof-of-stake (PoS) | ethereum.org. Available at: https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/, last accessed 12.09.2023.
Disclaimer
Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions-, und/oder Handelsberatung dar. Wir empfehlen dir dringend, die notwendigen Nachforschungen anzustellen, bevor du eine Anlage-, Investitions- und/oder Handelsentscheidung triffst. Bitte beachte, dass man von der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen kann.
Eine Haftung der Gruppe Börse Stuttgart und ihren Tochtergesellschaften für den Artikel ist ausgeschlossen.